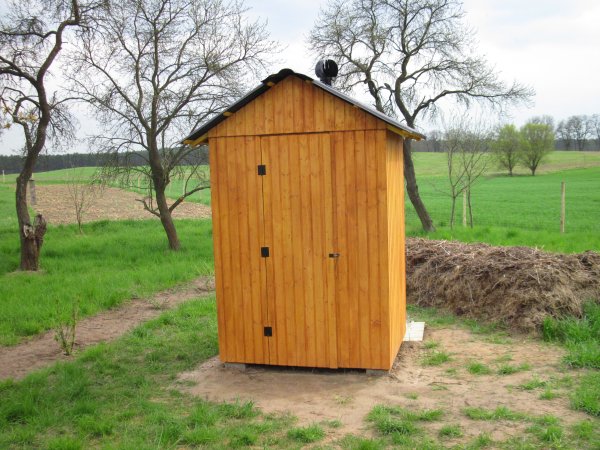Hallo ihr
Wald-,
Garten-,
Umwelt-,
Selbstversorgungs-
und sonstige FreundInnen!
Wir, Monika und Bernd, laden euch zur Baumpflanzaktion 2013 in "Füchsleins Naschgarten" ein.
Wer mitpflanzt, kann später auch miternten.
Wann? Sonnabend/Sonntag 2./3. November
Wo? Münchehofe bei Müncheberg, Alte Seestraße 7
Wie kommst du von Berlin dorthin?
Mit Oderlandbahn (NEB) ab Lichtenberg (7.34, 9.34, 11.34, 13.34, ...)
Richtung Kostrzyn, bis Obersdorf,
Fahrrad mitnehmen,
in Obersdorf nach links (bezogen auf die Zugfahrtrichtung), den Ort durchqueren,
den Abzweig links nach Münchehofe nehmen,
in Münchehofe an der Kirche links in die Alte Seestraße einbiegen,
wo die Nummer 7 und der Name Lisek am Briefkasten stehen, da findest du uns.
(3,5 km vom Bahnhof Obersdorf.)
Bitte gib vorher Bescheid, falls du kommen willst.
Im Frühjahr begannen wir ohne viel nachzudenken den ersten Teil unseres neuen Gartens
mit allerlei Obststräuchern zu bepflanzen.

Natürlich war uns klar, dass die Erde rings um unsere Sträuchlein nicht so "sauber"
bleiben würde wie am Anfang.
Zuerst hatten wir die (etwas naive) Idee auf den freien Flächen erwünschte oder
sogar nutzbare Kräuter wachsen zu lassen bzw. gezielt anzusiedeln. Einige Wochen lang
schien das gut zu gehen.



Aber dann kamen die Disteln, Brennnesseln und anderen Plagegeister.
So eine Distel kann ja mal ganz schön sein ...



... aber im Garten werden die stacheligen Gesellen doch sehr schnell lästig,
insbesondere wenn sie sich ungehemmt ausbreiten.
Nun kommt erschwerend hinzu: Die noch zu bepflanzende Fläche (die, wie man auf den folgenden
Fotos sieht, nicht gerade klein ist) war bis zum vorigen Jahr ein Kornfeld.



Der Boden sollte sich von der einseitigen Acker-Nutzung erst einmal etwas erholen.
Deshalb hatten wir auf einem Teil der Fläche im Frühjahr Lupinen eingesät.
Das war sicher kein Fehler. Ein Streifen wurde nur umgebrochen. Auf dem Restabschnitt, der völlig
unbearbeitet blieb, ernteten wir für den Eigenbedarf etwas Korn, das sich aus den ausgefallenen Körnern
des Vorjahres entwickelt hatte.

Auf einem ehemaligen Acker
Obstbäume und -sträucher anzusiedeln gilt mit Recht als besonders schwierig. Kann es uns mit
vertretbarem Aufwand gelingen? Oder wird schon im nächsten Jahr alles Gepflanzte unter
Beifuß, Disteln, Brennnesseln, Klettenlabkraut, ... versinken? Müssen wir auf Dauer
durch hohe Disteln tappen? Oder lässt sich zwischen den Nutzgehölzen ein angenehmeres
Gras-Kräuter-Gemisch halten? Welche Alternativen gibt es?
Antworten kann uns vielleicht die Pflanzensoziologie geben.
Die Pflanzensoziologie beschreibt, welche Pflanzenarten in der Natur an bestimmten Standorten
gemeinsam vorkommen (können) und warum sie dies tun.
Unser Ausgangspunkt ist zunächst eine Getreideacker-Unkrautgesellschaft, wie sie zum Beispiel
durch Kornblumen, Mohn und (geruchlose) Kamille charakterisiert ist. Der im vorigen Jahr in Nutzung
genommene und zuvor stark verkrautete Teil des Gartens befindet sich größtenteils im Zustand
einer Fettwiese. Kleine Teile zeigen Merkmale einer Queckenrasengesellschaft, die Wegeflächen entwickeln
Trittpflanzengesellschaften.


Wohin wird sich unser ehemaliger Acker entwickeln? Auch zu einer Fettwiese oder
(im anderen Extremfall) zu einer von der gewöhnlichen Eselsdistel (Foto) bestimmten Gesellschaft?
Dazwischen gibt es diverse Möglichkeiten:
- Hackunkraut- oder Ruderalgesellschaften kurzlebiger Pflanzen entstehen, wenn wir die Fläche
regelmäßig hacken.
- Würde regelmäßig gemäht, dann hätten Fettwiesengesellschaften oder
(falls der Boden trockener als erwartet bleibt) Queckenrasen eine Chance.
- Ist unser Standort tatsächlich so warm, wie er im ersten Vergleich mit Strausberg erscheint,
könnten wir mit thermophilen Saumgesellschaften und Staudenfluren (mit Dost, Storchschnabel-Arten und
vielen anderen Kräutern) rechnen.
- Sehr wahrscheinlich ist bei nicht flächendeckender Bearbeitung das Entstehen von
Beifuß-Ruderalgesellschaften in ihren vielfältigen Varianten (zum Beispiel mit
Zaunwinde und Giersch - auch nicht gerade das Ziel unserer Wünsche, Gundermann und Wiesenkerbel,
Kletten und Taubnesseln oder Eselsdisteln und Reseden).
Ein Sonderfall ist die Möglichkeit Nummer 2. Eine stabile, zu Pflege- und Erntearbeiten begehbare Wiese
wäre zwischen den Obstgehölzen durchaus zu erreichen. Voraussetzung wäre jedoch die
ständige Mahd oder Beweidung. Erstere lehnen wir wegen des hohen Energieaufwands (in Form von
Kraftstoff!) ab, letztere setzt die Beschränkung auf Hochstammobst voraus. Dann hätten wir
eine Streuobstwiese - ein langfristig funktionierendes, aber pflegebedürftiges Ökosystem.
Da wir auf kleinere Obststräucher nicht verzichten wollen, kommt auch dies für uns nicht
in Frage. Auf Dauer eine Wiese zu entwickeln ist also keine Option.
Mit Ausnahme des Falls 1 (regelmäßiges Hacken - was angesichts der Flächengröße
unrealistisch ist) enthalten alle ansonsten zu erwartenden Gesellschaften Kratzdisteln und viele (angesichts des
nährstoffreichen Bodens) auch Brennnesseln. Keine schönen Aussichten.

Na gut! Nehmen wir einmal an, eine mehr oder weniger lange Distel- und Brennnesselzeit ließe
sich nicht vermeiden. Was würde danach geschehen? Sofern der Boden durch die landwirtschaftliche Nutzung
nicht allzu sehr degradiert und irreversibel geschädigt ist (was wir eigentlich nicht befürchten),
würde sich an unserem Standort auf lange Sicht wieder der hier heimische Eichen-Hainbuchen-Mischwald entwickeln.
Zuvor wären einige Vorwald- und Gebüsch-Stadien zu durchlaufen. All das ist natürlich
nicht unser eigentliches Ziel.
Wenn wir uns die Zusammensetzung der entsprechenden Pflanzengesellschaften einmal ansehen, dann fallen
Überschneidungen mit der Liste der von uns gewünschten Fruchtgehölze auf.
Süß- und Sauerkirschen, Äpfel, Pflaumen, Esskastanien, Ebereschen,
Winterlinden, Mispeln und Haseln passen bestens hierher. Das legt die folgende Zielvorstellung nahe:
Es soll ein Waldgarten werden, das heißt eine den natürlichen Wald- und
Gebüschgesellschaften
ähnliche Pflanzengesellschaft, in der die Nutzgehölze dominieren.


Mit einem Waldgarten (einer Permakultur - über die Begriffe wollen wir hier nicht streiten) haben
wir in Strausberg bereits gute Erfahrungen gemacht. Solche waldähnlichen Pflanzengemeinschaften
können über lange Zeit stabil funktionieren. Und das beste: Der Arbeitsaufwand ist minimal.
Von den gefürchteten Plagegeistern bleibt uns dann (wie ein Blick in die Charakteristika des
Eichen-Hainbuchenwaldes ebenso wie die Betrachtung der umliegenden realen Wälder zeigt)
vermutlich nur noch der Giersch.
Wie können wir unser Ziel erreichen?
Die Pflanzensoziologie brachte uns auf die folgende Idee:
Warum sollte es nicht möglich sein, die natürliche Abfolge der Pflanzengesellschaften
bis hin zum gewünschten Zielzustand etwas zu beschleunigen bzw. zu verkürzen,
indem wir Arten, die eigentlich erst etwas später an der Reihe wären,
schon zu Anfang mit einbringen? Die Pflanzen werden diesen "großen Sprung" sicher um so
besser akzeptieren, je schneller es gelingt, die für spätere waldähnliche Phasen typischen
und notwendigen schattigen und halbschattigen Flecken herzustellen (die unsere Kratzdisteln
mit Sicherheit unterdrücken werden). Dazu wollen wir die nach soziologischen
Gesichtspunkten ausgewählten Gehölze in der notwendigen Dichte nahezu lückenlos pflanzen.
Ob das so funktioniert, wissen wir nicht. Es ist ein groß angelegtes Experiment. Insbesondere ist
unklar, ob und wie schnell der Boden mitspielt. Spannende Beobachtungen stehen uns bevor.
Da sich die Zwischenschritte auf dem Weg zum Eichen-Hainbuchenwald nicht mit Sicherheit voraussagen lassen,
weil mehrere Wege und eine beträchtliche Zahl von Pflanzengesellschaften nicht auszuschließen sind,
wissen wir nicht so genau, welche Gehölze für unsere Idee am besten geeignet sind. Deshalb wollen wir
auf den beiden Seiten des die Fläche teilenden Mittelweges zwei verschiedene Varianten ausprobieren:
Die tiefer liegende Hälfte wollen wir, in Anlehnung an den Verband von Vorwaldgesellschaften
Sambuco-Salicion capreae, mit Holunder, Salweiden, Zitterpappeln, Feldahorn, Stiel- und Traubeneichen füllen.
Auf der anderen Hälfte orientieren wir uns an der Gebüsch-Ordnung Prunetalia und pflanzen
wilde Vogelkirschen, Ebereschen, Haseln, Feldulmen, Zitterpappeln, Feldahorn, Stiel- und Traubeneichen
zusammen mit Kirsch- und Pflaumenbäumen sowie Brombeeren.
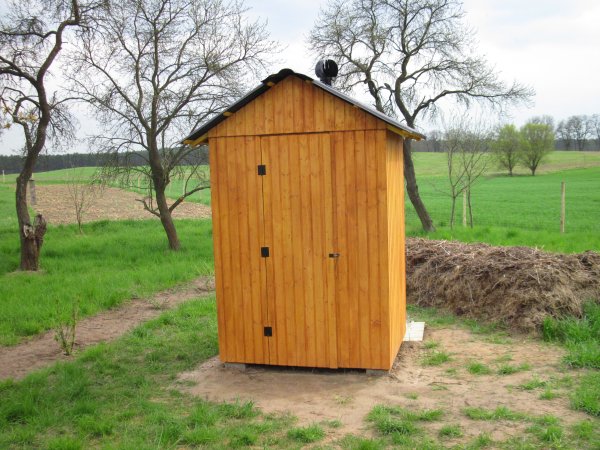
Am Rande der Pflanztage können wir gern auch über andere Öko-Themen wie z.B. diese
Komposttoilette nach vietnamesischem Vorbild reden.
Neugierig geworden? - Dann komm zu uns!